V#15/16 Texte einer Ausstellung
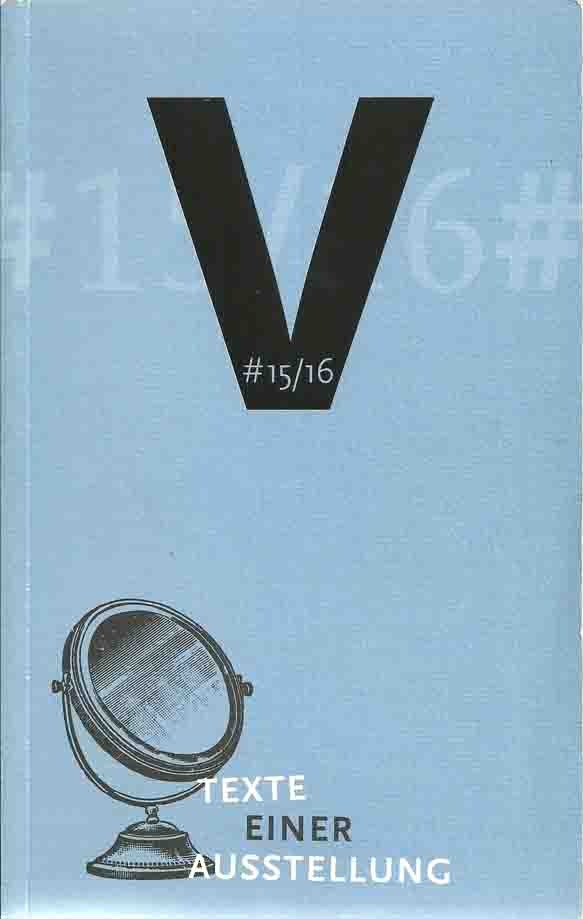
Die V#15/16 Texte einer Ausstellung wurde von Roger Vorderegger herausgegeben. Sie erschien 2005.
Editorial: Vor dem Spiegel
Roger Vorderegger
Wir sind nicht ohne Blicke. Wir bedürfen ihrer, um zu leben. Denn Blicke sagen uns, was immer sie sonst noch vermögen, wer wir sind. Gesetzt den Fall, wir hätten sie nicht, wären irgendwo ganz allein, irgendwo in der Wüste mit nichts als der Sonne und dem Himmel über uns und dem Sand, dem veränderlichen, unter uns, wohl ausgestattet zwar mit Trinken und Essen, einer Gelegenheit zum Schlafen und allem möglichen, aber wir würden allmählich alles vergessen, verges-sen, was früher war, wer wir waren, wie wir heißen, wir würden nur da sein unter der Sonne und dem weiten Himmel und die Hitze spüren oder die Kälte in der Nacht, den Durst und das Brennen auf unserer Haut. Und wir würden immer dort sein und einfach so leben, so ganz nah bei uns selber und ganz allein. Das würde doch heißen: Wir leben zwar, fühlen uns leben und doch unser Leben nicht. Denn dieses wird erst, indem wir aus uns heraustreten, indem wir das Brennen auf unserer Haut nicht nur fühlen, sondern begreifen, daß wir es sind, die diesen Schmerz empfinden.
Wer aber ist das: wir oder du oder ich? Wie wird man, wer man ist? Wie wird man überhaupt irgendwer? Eben indem man sich betrachtet, all-gemeiner, sich wahrnimmt oder betrachtet wird. Ein Kind, auf dem nicht der liebende Blick der Mutter ruht, ist verloren. So auch als Individuum der, der jenen Spiegel nicht hat, der ihm erlaubt, Ich zu sagen. Wer nicht gesehen wird, ist nicht, das ist philosophisch wie sozial ein kaum widerlegbarer Sachverhalt. Erst im Blick eines Du kommen wir zu uns selbst, erst wenn man weiß, daß es uns gibt, kann man sich unserer Probleme annehmen. So werden wir, indem wir ein Bild von uns gewinnen, indem wir sehend gesehen werden. Das Bild aber, das sich da einstellt, das sind nicht wir selber. Der Spiegel ist nie rein. Immer sind wir anders, als wir uns selbst sehen, immer anders, als die anderen uns wahrnehmen. Wären wir auf diese ange-wiesen, so verlören wir uns ganz. Denn unter deren Blicken löst unser Ich sich in tausend Facetten auf. Unet sohn ti Ohne diese Blicke tar das sich nicht zu haben, es ist imineris wissen ne Konstruktion. as reine, das eine, das wahre ich ist, wie ie wisseng, ne lillusion. Wir sind miche der oder die, wir sind immesiwahrnehmen griecformt von den Blicken anderer und unserer Selbstwahmet auchg, sehend uns selbst und unsere Welt konstruierend – und immer auch das Bild, das wir von uns haben. Dieses ist selten klar, in der Regel yage, weich und doch eines, das uns auch Halt gibt. Und: es ist ganz inwendig. Wit zeigen es nicht gern. Wir sagen zwar, wir sind so und so, wie wir aber – die. sem Bild zufolge – „wirklich“ sind, sagen wir nicht. Wir könnten es auch kaum. Denn oft genug sind wir uns selbst ein Rätsel, Und nattir. lich gilt – im Hinblick auf Veränderlichkeit und den perspektivischen, durch Blicke und Konstruktion bestimmten Zugang -, was fürs Ich gilt auch für das Bild desselben. Dieses hat immer einen blinden Fleck. Wir sehen uns – und können uns doch nicht sehen. So löst sich das Problem des Blickes nur in einer endlosen Reihe von Symbolisierungen. Jeder Blick verweist auf einen anderen, jedes Bild auf ein weiteres. Im Selbstbildnis aber treffen sich Bild und Blick. Der flüchtige Blick versteinert gleichsam, wird dauerhaft und bedeutend. Und er sieht in gewisser Weise auch sich selbst.
Das Thema dieser Nummer heißt Mitgliederausstellung. Literatur Vorarlberg, so heißen wir jetzt, geschlechtsneutral – weil einige Autorinnen in einem Autorenverband sich nicht mehr ganz wohl, nicht ganz heimisch fühlten, ihnen fehlte das Weibliche in dem männlichen Namen, die Autorin eben, die kleine Endung „in“ -, Literatur Vorarlberg also stellt sich in diesem Band gleichsam selbst vor und aus, auch und vor allem aus gegebenem, aktuellem Anlaß. Wir heißen nun anders. Und wenn man seinen Namen ändert, fragt man sich auch, kann man sich fragen, wer man ist. Das aber erfährt man eben, indem man aus sich heraustritt und im Heraustreten sich sieht, sich zu sehen lernt und so ein Bild von sich gewinnt, das man dann auch zeigen, herzeigen kann.
Im konkreten Fall aber kann das nur heißen: die einzelnen Mitglieder zeigen von sich, was sie zeigen wollen, seien dies Haltungen, Stellung-nahmen, Texte, in diesem Moment, für diese Nummer. Als Porträt nicht sowohl des Verbandes als seiner Mitglieder reflektiert diese „V“ dergestalt – mit der Einschränkung, daß einige Autoren, Autorinnen fehlen – auch die Situation der Literatur in Vorarlberg in diesem Jahr 2005. Eine historische Nummer also in einem historischen Gedenk-jahr? Wir kennen ja alle die Daten, die Ereignisse. Nein, das wäre ein wenig zu hoch gegriffen – und daneben. Man sollte sich nicht selbst historisch nehmen. Man verfällt dabei allzu leicht der Rache beider, des Lebens und der Geschichte. Und es sollte sich schon gar nicht selbst historisch nehmen, das wissen wir spätestens seit Nietzsche, wer sich dem Leben, dem Lebendigen verpflichtet fühlt. Und das wollen wir doch, als Schreibende, uns dem Leben verpflichtet fühlen, jedenfalls die meisten von uns.
So ist diese „V“ eine Art Bestandsaufnahme geworden, nicht mehr, nicht weniger, entstanden in einem bestimmten lebendigen Moment, ein Reflex der Situation, der Gegenwart der Vorarlberger Schriftsteller, eine (freilich höchst indirekte) Porträtserie, eine Textsammlung, ein Diskussionsfeld.
Und es ist insbesondere einigen Frauen zu verdanken, daß wir hier nicht nur der Vorarlberger Literatur, sondern auch dem literarischen Leben in diesem Land begegnen. Das ist der Sache nur dienlich, macht die Ausstellung spannend, lebendig, gelegentlich auch amüsant. So reflektiert sich, allerdings nur indirekt, was Ursache der Namensänderung war, noch in diesem Band, ist dieser auch ein Blick in den Spiegel – wo Bild und Blick sich begegnen.
Mit Beiträgen von Renate Aichinger, Stephan Alfare, Susanne Alge, Carola Bischof, Wolfgang Bleier, Gabriele Bösch, Lidwina Boso, Kurt Bracharz, Jytte Dünser, Daniela Egger, Jürgen-Thomas Ernst, Willibald Feinig, Christian Futscher, Ulrich Gabriel, Arno Geiger, Werner Grabher, Werner Hagen, Christine Hartmann, Wolfgang Herbert, Wolfgang Hermann, Christa Hutter, Roland Jörg, Rainer Juriatti, Franz Kabelka, Udo Kawasser, Elisabeth Klocker, Erika Kronabitter, Ulrike Längle, Gianni Lercari, Norbert Loacker, Norbert Mayer, Wolfgang Mörth, Oscar Sandner, Maria Schneider, Lisa Spalt, Ingo Springenschmid, Adolf Vallaster, Krista Vonbank, Anneliese Zerlauth, Verena Rossbacher, Simon Ganahl, Tobias Hagleitner, Livia Neutsch, Patrizia Pfefferkorn.


